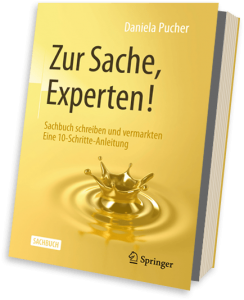Geschichten als Sinnstifter und Spaßfaktor
Wir Menschen sind erzählende Wesen. Wir erzählen uns selbst, unserem Tagebuch oder anderen Menschen, was wir erlebt haben und wie es uns geht. »Stell dir vor, gestern hab ich in der U-Bahn den Herrn Dr. Male getroffen, du weißt schon, den aus der Buchhaltung, der doch so unauffällig und zurückhaltend ist. Der war total locker gekleidet, mit Jean und Leiberl. Und an seiner Seite, du wirst es nicht glauben, eine Frau – einfach toll! Einen halben Kopf größer als er, schwarze, lange Locken, ein Mannequin nix dagegen! Das hätt‘ ich ihm echt nicht zugetraut, so was …«
Warum erzählen wir eine Geschichte so und nicht anders? Warum sich nicht einfach auf die Tatsachen beschränken? Hätte es nicht gereicht zu erzählen: »Herr Dr. Male ist gestern mit einer Frau U-Bahn gefahren«?
Hätte es nicht. Die ganze Spannung wäre weg, die Würze fehlte! Und damit ginge ein ganz wichtiger Effekt verloren. Überlegen Sie einmal. Wenn Ihnen jemand die zweite Version erzählt hätte, was hätten Sie damit gemacht? Genau: Sie hätten sie schnell wieder vergessen. Ganz anders bei der ersten Version. Ich wette, Sie würden sich diesen sensationellen Bericht merken und bei nächster Gelegenheit unbedingt jemand anderen wissen lassen wollen.
Sachinhalte in eine Geschichte verpackt merkt man sich also leichter. Diese Erkenntnis können wir beim Lernen anwenden.
Der Mensch lernt durch Geschichten
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal versucht haben, jemandem etwas zu lehren – ob als Lehrer, Trainer oder Elternteil. Aber ganz bestimmt haben Sie Erfahrung darin, etwas gelehrt zu bekommen. Dinge, die scheinbar nicht zusammenhängen, oder Abstraktes merken wir uns am schwersten. Erst wenn wir einen Sinnzusammenhang herstellen, wird es leichter. Und wenn wir der Geschichte dann noch ein wenig Würze verleihen, dann ist sie besser als jede Eselsbrücke. Beispiel gefällig?
Ein Ausflug in die unendlichen Weiten der Buchhaltung lässt uns wissen, was eine Bilanz ist: nämlich eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital, wobei wir zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und zwischen Eigen- und Fremdkapital unterscheiden müssen. Sehr spannend. Wenn Sie diese Definition aufgetischt bekommen, werden Sie sich schwer tun.
Wie wär’s aber mit dieser Geschichte? Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich endlich einen Herzenswunsch erfüllen und einen Maronistand eröffnen. Schon seit einem Jahr haben Sie Geld dafür gespart und sind stolz auf Ihre 1000 Euro im Geldbörsel (das ist also Ihr eigenes Kapital). Ihre Schwiegermutter war immer schon ein Fan von Ihnen und ist überzeugt von Ihrer außergewöhnlichen Idee, daher borgt Sie Ihnen 500 Euro, die sie irgendwann wieder zurückhaben möchte (das ist fremdes Kapital). Von den insgesamt 1500 Euro kaufen Sie einen Ofen um 700 Euro (damit ist Ihr Geld gut »angelegt«, weil den brauchen Sie ganz dringend – Ihr Ofen ist also »Anlage«vermögen) und Maroni um 200 Euro (Umlaufvermögen: die Maroni wollen Sie ja in Umlauf bringen), es bleiben Ihnen also 600 Euro im Geldbörsel…
So eine Geschichte merken Sie sich. Wenn Sie nicht das Glück haben, einen Geschichten erzählenden Trainer zu haben, dann rate ich Ihnen: Erfinden Sie selbst Geschichten zu dem, was Sie sich merken wollen. Damit erwischen Sie zwei Fliegen mit einem Schlag: Sie lernen leichter und es macht Ihnen auch noch Spaß!
Herzlichst, Ihre Daniela Pucher
 In diesem Blog schreibe ich über meine Gedanken zum Sachbuchschreiben und das Leben als Autorin. Ich freue mich, wenn du mitliest, teilst, kommentierst!
Viele konkrete Tipps fürs Sachbuchschreiben findest du in meinem Buch:
Zur Sache, Experten! Sachbuch schreiben und vermarkten. Eine 10-Schritte-Anleitung. (Springer 2020)
In diesem Blog schreibe ich über meine Gedanken zum Sachbuchschreiben und das Leben als Autorin. Ich freue mich, wenn du mitliest, teilst, kommentierst!
Viele konkrete Tipps fürs Sachbuchschreiben findest du in meinem Buch:
Zur Sache, Experten! Sachbuch schreiben und vermarkten. Eine 10-Schritte-Anleitung. (Springer 2020)