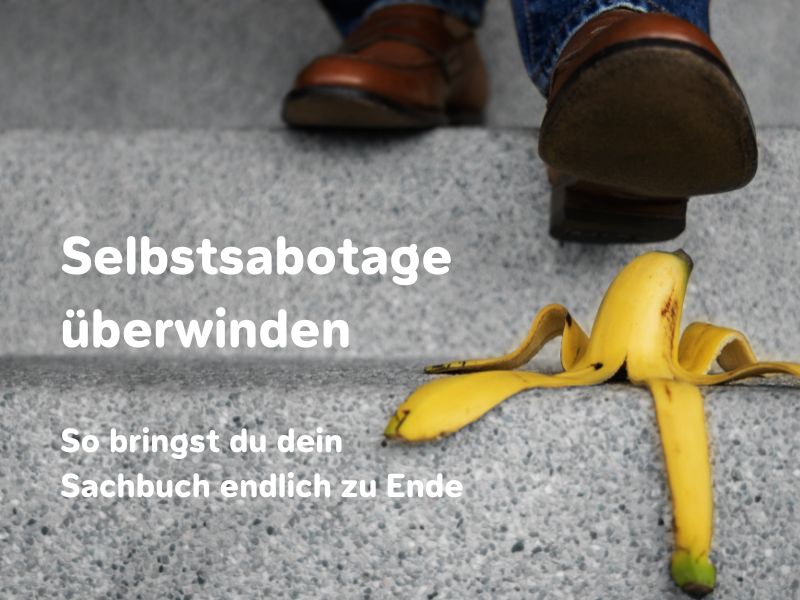Kennst du das Gefühl, dass du dir selbst im Weg stehst, obwohl du doch weißt, was du willst? Du wolltest immer schon ein Buch schreiben – aber es kommt nie dazu. Du hast damit begonnen, aber du kommst nicht weiter. Du schreibst, verwirfst es wieder. Schreibst, hörst wieder auf. Schreibst – und raufst dir die Haare, weil du feststeckst. Vielleicht bist du mit deinem Manuskript sogar schon recht weit gekommen. Doch du bringst es nicht zu Ende, weil es nicht perfekt genug ist. In Panik schreibst du alles um, doch dadurch wird alles noch schlimmer. Diese Verhaltensweisen sind typisch für Selbstsabotage. In diesem Artikel erfährst du, warum wir uns selbst sabotieren, wie du diese Blockaden erkennst und was du konkret tun kannst, um Selbstsabotage zu überwinden.
Was du in diesem Artikel erfährst
Selbstsabotage ist jedes Verhalten, mit dem du dir im Weg stehst, um deine Ziele zu erreichen.
Die typischen Symptome beim Schreiben: nie anfangen, stecken bleiben, immer und immer wieder überarbeiten, nicht abschließen können.
Der Saboteur meint es eigentlich gut mit dir: Er will dich schützen!
Trotzdem ist es gut, wenn du sie überwinden kannst: Am Ende des Artikels findest du 5 Anregungen dazu.
Was ist Selbstsabotage?
Manchmal verhalten wir uns schon recht seltsam: Wir träumen schon lange davon, endlich ein Buch zu schreiben, aber wir schieben es auf die lange Bank. Es ist wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens: Wir lieben unseren Partner, und trotzdem nörgeln wir ständig an ihm herum. Wir wissen, dass wir Zucker nicht vertragen – und lassen uns trotzdem zu oft verführen. Selbstsabotage ist also im Grunde jedes Verhalten, mit dem wir unsere eigenen Wünsche und Ziele durchkreuzen.
Wobei das nichts Ungewöhnliches ist. In gewisser Weise tun wir das alle. Die Vorstellung, stets vernünftig und rational zu sein, ist zwar vielleicht ganz nett, aber wenig realistisch. In meinem Wirtschaftsstudium habe ich den „homo oeconomicus“ kennengelernt, der immer rational entscheidet mit dem Ziel der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Hat sich längst widerlegt. Erfolgreich sind wir nicht dann, wenn wir selbstsabotage-befreit sind, sondern wenn wir wissen, wie wir mit diesen Hürden gut umgehen können.
Typische Formen der Selbstsabotage beim Schreiben
Chronische Aufschieberitis ist ein typisches Symptom. Ich stelle mir dabei immer so einen Gremlin vor, der sich vor dir aufbaut, die Hände in seine Seiten stemmt und dich grimmig anpöbelt: „Was glaubst du, wer du bist, dass du so dich wichtig machen und ein Buch schreiben kannst?“ Oder: „Ein Fachbuch, das können doch nur echte Experten schreiben, aber du?“ Oder: „Du wirst schon sehen, deine Fachkollegen werden dich in der Luft zerreißen!“ Oder: „Mein Buch wird doch eh keiner kaufen wollen.“ Schon ziemlich fies, oder!
Doch selbst wer bereits mit dem Schreiben begonnen hat, ist nicht gefeit. Das Nie-zu-Ende-Bringen, Selbstzweifel oder Perfektionismus sind weit verbreitet. Woran du das erkennst? Wenn du viel zu lange an Formulierungen herumtüftelst beispielsweise, einzelne Worte auf die Waagschale legst. Verstehe mich nicht falsch, es ist schon gut, verständlich und lesergerecht zu schreiben, wie du hier nachlesen kannst. Doch bei zu viel Unsicherheit wird die Sprachpflege zu einer never-ending story. Sehr „beliebt“ bei vielen Autorinnen und Autoren auch die Panik kurz vor Abgabeschluss. Welche Reflexe dabei hochkommen können, habe ich in diesem Beitrag beschrieben.
Wofür ist Selbstsabotage gut?
Eine paradoxe Frage, ich weiß. Doch ich bin der Meinung, dass kaum etwas auf dieser Welt nicht auch für etwas gut ist. Selbst ein Knüppel, den man sich selbst zwischen die Beine wirft. Die Psychologie dahinter ist auch recht einleuchtend:
- Selbstschutz: Wenn du dein Buchprojekt ewig vor dir her schiebst und das Buch nie veröffentlicht wird, kannst du auch nicht scheitern. Niemand kann dir dann so vernichtendes Feedback geben wie „schlecht geschrieben“ oder „die Inhalte sind nicht korrekt“ oder „schlecht recherchiert“. Du bleibst im sicheren Hafen und beschäftigst dich nur mit Dingen, wo du genug Selbstsicherheit hast. Keine Unsicherheit, keine Ängste, keine Überforderung, das ist das Gute daran.
- Kontrolle: So ein Buchprojekt ist auf jeden Fall ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Du weißt vorher nicht, wie es dir beim Schreiben geht, ob du es überhaupt gut genug kannst. Du weißt nicht, ob es dir tatsächlich Spaß machen wird. Du weißt nicht, ob du es zu Ende bringen wirst. Du weißt nicht, wie deine Leserinnen und Leser, deine Kolleginnen, Freunde und Familie darauf reagieren werden. Kein Misserfolg, keine Enttäuschung über das eigene Nicht-Können oder Nicht-Mögen.
- Ambivalenzen: Soll ich oder soll ich nicht? Indem dein innerer Schweinehund kategorisch Nein sagt, sparst du dir viel Kopfzerbrechen.
- Emotionale Entlastung: „Morgen fange ich aber wirklich an“ löst ein gewissen Unbehagen aus. Spätestens morgen früh bekommst du Stress und fühlst dich unter Druck. Indem du „wieder nicht“ beginnst, entlastest du dich von diesen unangenehmen Empfindungen.
Du siehst, dein innerer Saboteur meint es gut mit dir. Doch das soll kein Grund sein, deine Selbstsabotage nicht zu überwinden. Denn die Erleichterung, die dir der Saboteur bringt, ist nur kurzfristig. Langfristig entsteht Frustration und vielleicht tauchen dann erst recht Selbstzweifel auf (die eigentlich eine Ursache für Selbstsabotage sind). Auch nicht schön!
Selbstsabotage überwinden: 5 praktische Tipps für Autoren
Diese Anregungen sind sowohl für die chronischen Aufschieber wie auch für jene passend, die mitten im Buchprojekt feststecken.
Erstens: Finde heraus, was hinter deinem Gremlin steckt. Liegt es daran, dass du an deiner Schreibkompetenz oder deiner fachlichen Kompetenz zweifelst? Oder bist du nicht ganz sicher, ob du wirklich dieses Buch schreiben sollst? Hast du „eigentlich“ kein „richtiges“ Thema? Oder zweifelst du an deinem gewählten Thema? Welche Glaubenssätze behindern dich?
Zweitens die nächste Frage: Wofür soll es gut sein, dass du dieses Buch schreibst, das dir vorschwebt? Stell dir einmal vor, ein Wunder geschieht und es ist geschrieben. Jetzt liegt es am Ladentisch und kann von jedem gekauft werden. Was ist jetzt anders? Wie fühlt es sich an? Was kannst du jetzt tun? Schreib alles auf!
Drittens: Wo du schon beim Schreiben bist, kannst du gleich weiterschreiben. Worüber möchtest du gern ein Buch schreiben? Brainstorme mögliche Themen. Danach schreib zu jedem Thema eine Seite zur Frage: Was hat dieses Thema mit mir zu tun? Oder: Was fasziniert mich daran? Was motiviert mich, darüber zu schreiben? Wenn du mitten drin steckst: Hole dir deine ursprüngliche Motivation heran. Wofür ist es wichtig, dass dieses Buch zu Ende geschrieben werden muss?
Viertens: Was könnte ein erster kleiner (!) Schritt sein, um weiterzukommen?
Fünftens: Hole dir Hilfe von außen. Das kann eine Freundin sein, der es ein Anliegen ist, dass du dir endlich deinen Wunsch erfüllst. Oder ein Kollege, dem du vertraust und mit dem du wöchentlich oder monatlich einen Jour-fixe vereinbarst. Oder du holst dir professionelle Hilfe in Form eines Autorencoachs, der den Buchmarkt kennt und schon viele Schreibprozesse begleitet hat. Der weiß, welche Hürden so ein Gremlin aufbauen kann und wie du sie überwindest.

Sachbücher, die bewegen – das ist mir ein großes Anliegen: Denn wofür sollen Bücher sonst da sein, als die Leser zum Denken, Fühlen oder Handeln zu bewegen?
Ich bin Autorencoach und habe selbst schon viele Bücher geschrieben – viele in meiner Zeit als Ghostwriter, doch auch schon einige unter eigenem Namen. Außerdem schreibe ich regelmäßig im onlineMagazin sinnundstift darüber, wie man das Leben sinnvoller und damit bunter gestalten kann. Egal ob hier im Autorenblog oder drüben bei sinnundstift – ich freue mich sehr, wenn du dich als Abonnent*in einträgst und bei mir mitliest.